Die ersten Menschen
Der Mensch war nicht immer das, was wir heute von ihm kennen. Über Millionen von Jahren sind wir erst zu dem geworden, was wir heute sind. Mit der Trennung der Hominiden (Menschartigen) von den Pongiden (Menschenaffen) vor acht Millionen Jahren begann die eigentliche Geschichte des Menschen in den afrikanischen Tropenwäldern. Im Laufe der nächsten circa vier Millionen Jahre entwickelten sich verschiedene Spezies, die bereits aufrecht gehen konnten. Vor rund vier Millionen Jahren bildete sich der Australopithecus anamensis heraus, der heute als die früheste Hominini- und damit Menschenart gilt.
- 620 Seiten - 08/30/2018 (Veröffentlichungsdatum) - Dorling Kindersley Verlag GmbH (Herausgeber)
Durch eine Klimaabkühlung vor rund zweieinhalb Millionen Jahren setzte eine Verringerung des Niederschlages ein, die zu einer weitreichende Versteppung Afrikas führte. Die so entstandene savannenartige Landschaft war für Grasfresser deutlich besser geeignet als für Fleischfresser. Zusätzlich sorgte der erlernte aufrechte Gang für einen besseren Überblick über die Savannen- und Steppenlandschaft. Durch die veränderten Bedingungen entstanden zwei unterschiedliche Typen von Hominini. Der erste Typ entwickelte eine enorme Kaumuskulatur, mit der er die hartfaserige Nahrung kauen konnte. Der andere Typus passte sich an die Folgen des Klimawandels an, indem er in seine Ernährung Fleisch miteinbezog. So entwickelte sich aus dem Australopithecus vor zwei bis drei Millionen Jahren die Gattung Homo.
Als erster Homo verließ der Homo erectus den afrikanischen Kontinent und breitete sich nach Asien und Europa aus. Der Homo erectus existierte bis 500 000 v. Chr. und war die erste Menschenart, die das Feuer nutzte und Faustkeile herstellte. Dies waren wichtige Voraussetzungen, um Afrika verlassen zu können. Dabei war die Jagd eine wichtige Triebkraft. Die Suche nach Beute führte den Homo erectus in weit entfernte Gebiete, was in der Folge zu einer Ausdehnung des Lebensbereiches über Afrika hinaus führte. Dass der Homo erectus spätestens vor zwei Millionen Jahren den Kontinent verließ, korreliert darüber hinaus mit klimatischen Daten, die sich heute rekonstruieren lassen. Aufgrund der Klimaerwärmung kam es zu einer geografischen Ausdehnung der Pflanzenwelt, der sich der Homo erectus anschloss und ihn bis nach Asien führte.
Der moderne Mensch und der Neandertaler
Zu den zweifellos wichtigsten Nachkommen des erectus zählt der heidelbergensis. Er entwickelte sich wahrscheinlich vor circa 800 000 Jahren aus der Gattung des Homo erectus und wies im Vergleich zu diesem ein größeres Gehirn auf. Diesem folgte zeitlich versetzt der Neandertaler (Homo neanderthalensis), der sich vor ungefähr 250 000 Jahren in Europa niederließ. Sein Ursprung ist bisher ungeklärt. So ist es möglich, dass er entweder vom Homo erectus abstammt oder eine Unterart des Australopithecus ist. In Afrika bildete sich unabhängig vom Neandertaler eine weitere Unterart des Homo erectus aus: der Homo sapiens. Die ersten Spuren dieser Gattung, die man im Nordosten Afrikas fand, waren circa 160 000 Jahre alt. Vor ungefähr 70 000 Jahren breitete sich der Homo sapiens einerseits über den Vorderen Orient, Indien und Indonesien bis nach Australien aus. Die zweite Ausbreitung erfolgte in Richtung Norden nach Europa und Zentralasien.
Nachdem der Homo sapiens aus Afrika aufbrach, besiedelte er im Gegensatz zum Homo erectus keine menschenleeren Flächen mehr, sondern begegnete anderen Arten. So trafen vor ungefähr 30 000 Jahren erstmals die Gattungen des Homo sapiens und des Neandertalers in Europa aufeinander. Beide Arten wiesen große anatomische Unterschiede auf. Obwohl der Homo sapiens dem Neandertaler körperlich unterlegen war, hatte er sich hinsichtlich seiner Erfahrungen und Kenntnisse weiterentwickelt und war zudem anpassungsfähiger als der Neandertaler. Durch seine geistige Überlegenheit konnte er sich schließlich mehr und mehr gegen den Neandertaler durchsetzen und diesen aus seinen angestammten Lebensräumen verdrängen. Vor etwa 25 000 Jahren starb die Spezies des Neandertalers schließlich aus.
Doch nicht nur in Europa setzte der moderne Mensch seinen Siegeszug fort. Auch der Homo erectus konnte sich gegen den Homo sapiens nicht behaupten. Es dauerte nicht lang, bis der Homo sapiens auf allen Kontinenten die einzige Menschengattung war.
Die Cro-Magnon-Menschen: Von Nomaden zu Bauern
Als Cro-Magnon-Menschen bezeichnet man die ersten in Europa lebenden Homo sapiens. Zeitlich umspannt dieser Abschnitt etwa 30 000 Jahre. Er begann vor circa 40 000 Jahren und fand seinen Abschluss mit dem Ende der letzten Eiszeit vor 12 000 Jahren. Anatomisch gesehen ist der Cro-Magnon-Mensch dem heutigen Homo sapiens sehr ähnlich, obwohl sie größer, muskulöser und robuster als die meisten jetzigen Menschen waren. Dennoch tauchen bereits damals viele Gemeinsamkeiten zum heutigen Homo sapiens auf. Der Schädel war hoch und gewölbt und das Gehirnvolumen mit über 1600 cm³ bereits recht groß. Zudem verlief die Stirn steil nach oben und das kurze Gesicht besaß rechteckige Augenhöhlen, wobei die Nasenöffnung hoch und schmal war. 1868 entdeckten Handwerker im südfranzösischen Cro-Magnon fünf Skelette, wobei es um drei erwachsene Männer, eine Frau und einen Säugling handelte. Offensichtlich waren die Körper absichtlich gemeinsam bestattet worden, wobei ihnen Körperschmuck wie durchbohrte Muschelschalen oder Tierzähne beigelegt wurden. Vermutlich wurden diese als Ketten getragen. Außerdem fand man in der Nähe Knochen von Wollmammuts, Bisons und Rentieren. Zusätzlich fand man Steinklingen und Messer. Diese Funde zeigen, wie ausgeprägt bereits das technische Verständnis des Cro-Magnons war. Darüber hinaus besaß er bereits ein religiös-kulturelles Empfinden, da er seine Toten feierlich mit Schmuck bestattete. Geschickte Jagdtechniken, die Fähigkeit Werkzeuge herzustellen sowie die Kunst der Höhlenmalerei zeichnete die Cro-Magnon-Menschen aus.
Nachdem gegen Ende der Eiszeit vor etwa 12 000 Jahren die Durschnittstemperaturen stiegen und die Gletscher allmählich zu schmelzen begannen, änderte sich auch das Leben der früheren Menschen. Sie fingen an Behausungen in der Nähe von Wäldern und an Flüssen zu bauen. Sie begannen außerdem, den Hund als Haustier zu zähmen sowie Kühe, Schafe und Ziegen zu züchten.
Auch der Anbau von Pflanzen als Nahrungsmittel begann zu jener Zeit. Damit wichen die Menschen von ihrem einstigen Prinzip des Jagens und Sammelns ab. In vorangegangenen Zeiten war der Urmensch durch das Nahrungsangebot und das Klima gezwungen gewesen, seine Lager je nach vorherrschenden Bedingungen zu wechseln und umherziehen. Das änderte sich allmählich. Die Menschen wurden sesshaft und fingen an, Nahrungsvorräte anzulegen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Neolithischen Revolution“, die den Beginn der Jungsteinzeit einleitete.
Im Zuge der einsetzenden Sesshaftigkeit begannen die ersten Siedler mit dem Bau von Hütten. So entstanden nach und nach erste Siedlungen, in denen immer größere Gruppen von Menschen zusammenlebten. Das wachsende Nahrungsangebot sorgte für auch für ein Wachstum der Bevölkerung und die Menschen vergrößerten ihren alltäglichen Lebensraum. Unwirtliche Gebiete machten sie durch neue Techniken bewohnbar, indem sie Gräben zu Bewässerung aushoben oder Dämme gegen Überflutungen bauten. Aus den Nomaden der Cro-Magnon-Zeit hatten sich Bauern und Siedler entwickelt.
Steinzeit: Erfinder und Entdecker
Mit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12 000 Jahren gelangte der moderne Mensch nach Europa. Während Norddeutschland noch unter einem dicken Eispanzer lag, lebten in Süddeutschland bereits Menschen als Jäger und Sammler in Gruppen zusammen. Dabei hausten sie größtenteils in Zelten oder Höhlen. Sie folgten den Rentierherden, die ihnen Nahrung und Kleidung lieferten. Das Fleisch kochten sie in Gruben und es entstand das Prinzip der Arbeitsteilung, nach dem die Männer auf die Jagd gingen und die Frauen Nahrung sammelten. Diese Zeit wird als Altsteinzeit bezeichnet.
Dabei besaßen die Menschen bereits eine Sprache, mit deren Hilfe sie ihr Wissen an ihre Nachkommen weitergeben konnten. Auch die künstlerischen Fähigkeiten wurden komplexer. Im heutigen Frankreich und Spanien entstanden beeindruckende Höhlenbilder und -malereien. Im Gebiet der Schwäbischen Alb fanden Wissenschaftler sogar Elfenbeinschnitzereien. Auch religiöse Rituale übten die Menschen der Altsteinzeit aus: Um die Verstorbenen auf ihr Dasein nach dem Tod vorzubereiten, wurden den Gräbern Schmuck und persönliche Gegenstände beigefügt.
Im Nordwesten Europas existierte die Kultur des Jagens und Sammelns bis etwa 3000 v. Chr. unter dem Namen Mittelsteinzeit fort. Im Südosten Europas lebten bereits Menschen, die Ackerbau betrieben und damit die Jungsteinzeit einleiteten.
Die Jungsteinzeit wird auch als Neolithikum bezeichnet. Der Begriff „Neolithische Revolution“ charakterisiert den Übergang vom bloßen Jagen und Sammeln zu Ackerbau und Tierhaltung. Ihren Ausgang nahm sie im Gebiet des sogenannten Fruchtbaren Halbmondes. Dieser erstreckt sich vom heutigen Ägypten im Süden bis in die Türkei im Norden und wurde östlich vom heutigen Iran begrenzt. Die vorherrschenden klimatischen Bedingungen ermöglichten die Ernte von Wildpflanzen und die Menschen fingen an, diese gezielt anzubauen. Außerdem siedelten sie nun dicht bei ihren Feldern, auf denen sie Weizen und Gerste anbauten und sie später in Tongefäßen zubereiteten. Auch zähmten sie Wildtiere und machten diese zu Haustieren. Zu den wichtigsten Erfindungen zählten Steinwerkzeuge, wie die Axt, mit deren Hilfe sie Wälder rodeten sowie Hacken zur Bodenbearbeitung. Auch der Häuserbau wurde weiter entwickelt. Die Kultivierung des Bodens ermöglichte es erstmals, Nahrungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften, was in der Folge zu einem Bevölkerungswachstum führte. Das Bevölkerungswachstum führte dazu, dass die Menschen in immer größeren Gruppen lebten. Die ersten Städte entstanden und mit ihnen die ersten Stämme und Reiche.
Als revolutionär wurde diese Epoche vor allem deshalb beschrieben, weil der Mensch erstmals begann, in die Umwelt aktiv einzugreifen. Durch Vorratshaltung entwickelten sich erste gesellschaftliche Züge, die zu einem differenzierten sozialen Gefüge führten: Es gab erstmal arme und reiche Mitglieder in den Gruppen.
Die Neolithische Revolution der Jungsteinzeit entwickelte sich allerdings nicht in allen besiedelten Regionen Europas und Asiens gleich. Während im erwähnten Gebiet des Fruchtbaren Halbmondes die Entwicklung kontinuierlich verlief, begann dieser Prozess in Mitteleuropa erst viel später nämlich, etwa 5500 v. Chr. Hervorzuheben ist jedoch, dass in Europa einige Entwicklungsetappen ausgelassen wurden. Im südlichen Afrika wurde die Periode des neolithischen Ackerbaus sogar komplett übersprungen, was sich an archäologischen Funden belegen lässt. Scheinbar trafen dort eingewanderte Ackerbauern der Eisenzeit auf die vor Ort noch immer dominierende Kultur der Jäger und Sammler. Verantwortlich für die geografische Verbreitung der Innovationen waren sowohl Handelsbeziehungen als auch Einwanderungen, die durch klimatische Veränderungen oder das Anwachsen der Bevölkerung begründet waren. Durch ausgedehnte Völkerwanderungen wurde der Fortschritte in entfernte Regionen der Welt gebracht.
Die Fortschritte der Jungsteinzeit führten hingegen auch zu Einschränkungen. So bedeutete die Konzentration auf den Anbau weniger Nutzpflanzen eine sehr große Abhängigkeit von der Ernte. Diese konnte klimatisch bedingt jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Die Sesshaftigkeit der Menschen verhinderte spontane Ortswechsel, sodass schlechte Ernten leicht zu Hungersnöten führen konnten.
Sumerer: Die erste Hochkultur
Bereits 7000 v. Chr. entstanden im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris Siedlungen, die sich auf die Landwirtschaft stützten. Im Zeitraum von 6000 bis 5000 v. Chr. wuchsen die Siedlungen so weit, dass der Platz in den wenig fruchtbaren und von Sümpfen und Wüsten geprägten Gebieten knapp wurde. Es kam daher zu einer Wanderbewegung in Richtung Süden. Die Siedler ließen sich in den überwiegend flachen und sumpfigen Gebieten der Euphratmündung nieder und gegründeten um 5000 v. Chr. die erste Hochkultur der Weltgeschichte. Die neuen Einwanderer begannen mit den Entwässerungen der Sümpfe und der Bewässerungen der Wüstengebiete. Ihren Namen erhielten sie von den bereits ansässigen „el-Obed“-Stämmen, die sie als „Sumerer-Kulturbringer“ bezeichneten. Eine besondere Schwierigkeiten lag in der Zähmung der Naturgewalten, da es immer wieder zu Hochwasser und Dürren kam. Auch permanente Angriffe von Nomadenstämmen erwiesen sich als problematisch. Insgesamt beförderten diese Herausforderungen jedoch das Zusammenwachsen der Siedlungen, sodass nach einiger Zeit erste Städte mit eigenen Befestigungsanlagen und sogar Tempeln entstanden.
Die sumerische Gesellschaft kannte in ihrer frühsten Phase weder Privatbesitz noch Eigentumsrecht. Besitzfragen zu klären oblag dem Stadtgott, der von einem Priester vertreten wurde. Grundsätzlich waren alle Bewohner der Stadtstaaten gleichgestellt. Im Verlauf der Jahre veränderten sich hingegen sozialen Ansichten, sodass circa 3000 v. Chr. erbitterte Kämpfe um Macht und persönlichen Besitz einsetzten.
Zeitgleich führte der intensivierte Bewässerungsanbau zum Bevölkerungszuwachs und aus einigen Stadtzentren entstanden sogenannte heilige Bezirke. Diese Entwicklung mündet in das Altsumerische Reich, welches eine erste Blüte in der Frühdynastischen Periode um etwa 2800 v. Chr. erreichte. Diese Zeit wurde von den Stadtstaaten wie Uruk, Lagasch oder Kisch dominiert, die von unterschiedlichen Stadtherrschern regiert wurden. Als erster wirklich bekannter Herrscher von Sumer wird Etana genannt, der König von Kisch war.
Durch die Akkader, die aus dem Norden kamen, wurde Sumer 2200 v. Chr. erneut unter einer Dynastie vereinigt und Akkadisch wurde zur Amtssprache. Allerdings hielt diese Phase nicht sehr lange und Streit zwischen den Akkadern und den Sumern ermöglichte es den Gutäern schließlich, das Sumerland zu erobern.
Unter der Herrschaft des Stadtstaates Ur setzte sich schließlich Sumerisch als Verwaltungssprache durch und die Entstehung von sogenannten Zikkuraten wurde begünstigt. Diese Phase um 2000 v. Chr. wird auch als Neusumerisches Reich bezeichnet, das erst durch das Reich Elam, das das Zweistromland eroberte, beendet wurde.
Den Sumerern gelang es, auf vielen verschiedenen Gebieten wichtige Neuerungen voranzutreiben. Dazu gehörten technische Entwicklungen, ein Justizsystem und eine eigene Literatur. Außerdem entwickelten sie sehr ausgeprägte Handelsbeziehungen und es gelang ihnen nicht nur Bronzearbeiten, sondern auch Segelschiffe, Wagen und Statuen herzustellen. Hinzu kam die Fähigkeit des Färbens und Webens. Die sozialen Strukturen Sumers waren ebenso hoch entwickelt. Die Monarchie wurde durch einen König, der gleichzeitig auch oberster Priester war, und seinen Ministern aufrechterhalten. Ein bürokratisch-administratives System kontrollierte die Ernten und sorgte für die gleichmäßige Verteilung der Nahrungsmittel. In jeder Region gab es einen Priester, der die Verantwortung dafür trug, dass die gerechte Verteilung an alle Einwohner gewährleistet wurde. Diese Aufgaben und Tätigkeiten der Priester wurden darüber hinaus schriftlich festgehalten und archiviert.
Mit dem Aussterben der Sumerer gingen einige Erfindungen und Fortschritte für viele Jahre verloren, was dazu führte, dass es lange dauerte, bis andere Zivilisationen den Entwicklungsstand der Sumerer erreichen konnten.
Ägypter und die Pyramiden
Etwa 3000 v. Chr. beginnt die Geschichte des alten Ägyptens mit der Erfindung und dem Gebrauch der Schrift. Das sogenannte Alte Reich, in welches auch der Bau der Pyramiden fällt, lässt sich ungefähr auf den Zeitraum von 2850 v. Chr. bis 2050 v. Chr. festlegen. Ihm folgten das Mittlere Reich (2050 v. Chr. bis 1570 v. Chr.) und das Neue Reich (1570–715 v. Chr.), an dessen Ende der Niedergang der Zentralgewalt stand. Als letzte Hauptphase existierte die Spätzeit bis 332 v. Chr., als mit dem Einfall Alexanders in Ägypten das Reich endgültig seinen Einfluss verlor.
Nachdem seit Beginn der Siedlungsgeschichte am Nil ein Ober- und ein Unterägypten existierten und beide Siedlungsgebiete völlig unabhängig voneinander waren, setzte sich um 3000 v. Chr. Menes als König durch. Es gelang ihm, beide Gebiete miteinander zu vereinen. Gleichzeitig übernahm Menes als erster Herrscher den Titel des Pharaos, der soviel wie „großes Haus“ bedeutet. Da der Pharao einen Großteil der Ernte bekam, war es ihm möglich, Reichtümer anzuhäufen. Gleichzeitig begann er das kulturelle Leben im Bereich der Architektur, Bildhauerei usw. zu fördern. Auslöser für viele kulturelle Entwicklungen war der Glaube an das Leben nach dem Tod und der sich daraus entwickelnde Totenkult. Dieser war bei den Ägyptern so stark ausgebildet war, dass sich die Menschen ihr ganzes Leben mit der Ausgestaltung ihres Grabes beschäftigten.
Dies basierte vor allem auf der Tatsache, dass die Ägypter glaubten, nach dem Tod in den Körper zurückkehren zu können und vor ein Totengericht zu treten. Dort sollten die Götter beurteilen, ob der Mensch ein gutes Leben geführt hatte. Fiel das Urteil negativ aus, wurde seine Seele von einem Ungeheuer verschlungen, während die Seele des guten Menschen mit dem alten Körper im Jenseits weiterleben konnte. Daher war es den Ägyptern besonders wichtig, dass ihr Leichnam erhalten blieb.
Am sorgfältigsten wurde der Pharao mumifiziert. Die Beigaben zu den Gräbern der Pharaonen waren sehr prunkvoll. Gerade hier lässt sich die besondere Bedeutung des Pharaos erkennen. Er stand an der Spitze der Gesellschaft und wurde als Vermittler zwischen den Göttern und Menschen angesehen. Ihm fiel die Aufgabe zu, die Weltordnung aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus war er verantwortlich für die Fruchtbarkeit und den Schutz des Landes. Da der Pharao ein großes Reich nicht allein regieren konnte, war er in den einzelnen Gebieten auf Stellvertreter angewiesen.
Die soziale Struktur in Ägypten differenzierte sich in verschiedene Klassen. Die oberste Schicht bestand aus Priestern und Offizieren sowie hohen Beamten. Unter dieser Schicht waren Schreiber, Ärzte, Kaufleute und Handwerksmeister angesiedelt. Dahinter folgten einfache Soldaten, Hauspersonal, Seeleute, Schauspieler und Tänzer. Die unterste gesellschaftliche Gruppe machten die Bauern aus, die die wichtige Funktion hatten, die Allgemeinheit mit Getreide zu versorgen. Wenn wegen Überschwemmungen oder Trockenzeiten der Ackerbau nicht möglich war, mussten die Bauern entweder beim Militär oder beim Bau der Pyramiden mitarbeiten.
Um 2640 v. Chr. begannen die Ägypter, ihre Pharaonen in pyramidenartigen Grabstätten zu bestatten. Zu Beginn bereitete der Bau den Ägyptern einige Schwierigkeiten und man begann zunächst, Stufenpyramiden wie die von Sakkara zu bauen. Der Höhepunkt in der Pyramidenbaukunst wurde durch die Pyramiden von Gizeh erreicht, die von Pharao Cheops vor etwa 4500 Jahren in Auftrag gegeben worden waren. Mit dem Bau der größten Pyramide wollte sich Cheops selbst ein Denkmal setzen, was ihm mit der 147 Meter hohen und einer Fläche von neun Fußballfeldern bedeckenden Cheops-Pyramide gelang. Im Inneren der Pyramiden finden sich bis heute völlig unbeschädigte Gänge – und das nach über 5000 Jahren. Besonders erstaunlich ist diese Tatsache, dass die Ägypter beim Bau der Pyramiden über keine eisernen Werkzeuge verfügten, sondern mit Hämmern oder Meißeln aus Stein oder Kupfer arbeiten mussten.
Chinesische Kultur und die Chinesische Mauer
Die chinesische Kultur kann ohne ihre spirituelle Basis nicht verstanden werden. Es gibt drei große Lehren in der chinesischen Kultur, die bedeutsam sind: Der Konfuzianismus, der heute zumeist als die wichtigste chinesische Kulturform betrachtet wird, geht auf den Gelehrten Kong Qiu zurück, dessen Name in latinisierter Form Konfuzius ist. Konfuzius setzte seinen Schwerpunkt auf die menschlichen und moralischen Beziehungen untereinander und leitete daraus zunächst verschiedene Tugenden ab, die ein Mensch besitzen müsse: Güte, Weisheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit und ethisches Verhalten. Aus diesen Tugenden leitete Konfuzius drei wesentliche soziale Pflichten ab, zu denen die Wahrung von Anstand und Sitte, die Verehrung der Alten und Ahnen sowie die Loyalität als Form der Untertanentreue zählten.
Vor allem die Bedeutung des (Selbst-)Studiums war Konfuzius sehr wichtig, um die Weltordnung verstehen zu können. Der Konfuzianismus geht weit über die klassischen westlichen Kategorien einer Religion oder Gesellschaftsordnung hinaus. Er muss vielmehr universalistisch verstanden werden und hat sich im Verlaufe von über 2500 Jahren fest in vielen Kulturen Ostasiens verankert.
Eine zweite große Strömung innerhalb der chinesischen Kultur macht der ebenfalls im sechsten Jahrhundert v. Chr. entstandene Daoismus aus. Er wurde von dem chinesischen Philosophen Laozi begründet und versteht sich im Gegensatz zum Konfuzianismus mehr als Religion und Philosophie. Kerninhalt ist das Vorhandensein des „Daos“, eines der ganzen Welt zugrunde liegenden Prinzips, das als etwas Absolutes angesehen werden kann. Es umfasst kosmische Gesetze ebenso wie Wirklichkeiten und Mysterien und ist in jeder Hinsicht unbegrenzbar, sodass es auch nicht definiert werden kann. Vor allem der Begriff der Spontaneität spielt eine große Rolle, da es darum geht, die natürlichen Dinge geschehen zu lassen. Diese Selbstordnung muss vom Menschen akzeptiert und darf nicht durch eigene Begierden und Wünsche gefährdet werden.
Als letzte der drei großen Lehren der chinesischen Kultur kam im 2. Jahrhundert n. Chr. der Buddhismus nach China und konnte sich schnell als neue Religion gegenüber dem Konfuzianismus und dem Daoismus etablieren. Die Grundlehre des Buddhismus besteht in der Akzeptanz der vier Wahrheiten. So ist das menschliche Leben durch Leid geprägt, welches durch drei wesentliche Gifte, der Verblendung, der Gier und des Hasses entsteht. Daraus folgt auch, dass das Leid beseitigt werden kann, wenn man dem sogenannten Achtfachen Pfad folgt, der unter anderem die richtige Erkenntnis und die richtige Anstrengung enthält. Aus den vier Wahrheiten heraus ergibt sich das Streben nach einem ethischen Verhalten, welches die Unvollkommenheit und das Leid schließlich überwinden kann, um letztlich das Nirvana als Zustand des höchsten Glückes zu erreichen.
Die Lehren des Buddhismus beeinflussten durch ihre große Anziehungskraft die chinesische Kultur stark und entfalteten ihre Wirkung in der Kunst insbesondere in vielen chinesischen Tänzen.
Das im Chinesischen als unendlich lange Mauer bezeichnete Bauwerk ist nach mehr als 2000-jähriger Bauzeit als das größte erbaute Konstrukt der Erde. Einschließlich sämtlicher Verzweigungen beträgt die Gesamtlänge ungefähr 6350 Kilometer. Sie verläuft durch fünf chinesische Provinzen von der Wüste Gobi im Westen bis zum Shanghiguan-Pass im Osten. Ihr heute charakteristisches Aussehen erhielt sie im Wesentlichen während der Ming-Dynastie vom 14. bis 17. Jahrhundert. Gebaut wurde sie ursprünglich, um das chinesische Reich gegen Angriffe aus dem Norden durch Nomadenvölker verteidigen zu können. Allerdings verlor sie ab Mitte des 17. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung, da die chinesischen Kaiser von da an mehr weniger auf Aggression als auf Diplomatie setzten. Dadurch setzte auch ein Verfall der Maueranlagen ein, sodass heute größere Abschnitte der Mauer nicht mehr begehbar sind.
Die alten Griechen: Demokratie, Philosophie, Mathematik
Das antike Griechenland war maßgeblich für die Ausprägung der europäischen Zivilisation verantwortlich. In einer verhältnismäßig kurzen Periode von circa 600 Jahren brachten die Stadtstaaten der Ägäis eine Vielzahl von Innovationen und neuen Denkrichtungen in den Geistes- sowie Naturwissenschaften hervor und begründeten das Prinzip der Volkssouveränität.
Als erste Demokratie erwies sich die sogenannte attische Demokratie in Athen. Nachdem der Archont Drakon die Regierung des Stadtstaates mit sehr harten (drakonischen) Strafen führte und dadurch für Verbitterung und Aufstände sorgte, übernahm Solon im Jahr 594 v. Chr. die Macht und erschuf eine erste Verfassung. In diesen Pflichten und Rechten der Bürger wurde die Bevölkerung in vier Klassen aufgeteilt in der alle männlichen Bürger Athens berechtigt waren, in der Volksversammlung Beamte zu wählen und Gesetze zu beschließen. Frauen und Sklaven waren nicht zugelassen.
Mit der Einführung des Scherbengerichtes unter Kleisthenes konnten die Wahlberechtigten auch über die Verbannung von Personen bestimmen, die der Freiheit des Volkes schaden konnten. Vor allem die Adligen, die sich gegen die Reformen des Solon lange gewehrt hatten, mussten nun einlenken, da sie sonst selbst aus der Stadt gewiesen worden wären. Nach der Friedenszeit unter Perikles geriet Athen in Konflikte mit anderen Stadtstaaten wie Sparta. Mehreren militärische Niederlagen besiegelten schließlich das Ende der Demokratie in Athen.
Mit dem Philosophen Sokrates begann die klassische Philosophie im antiken Griechenland. Typischerweise versuchte er seinen Gesprächspartner durch ständiges Nachfragen von dessen fester Meinung abzubringen. Dann förderte er bei diesem durch rhetorische Fragen, deren Antwort scheinbar logisch erschien, neue Erkenntnisse. Dieses Vorgehen bezeichnete er selbst als Mäeutik, die sogenannte Hebammenkunst.
Sein Schüler Platon entwickelte eigenständige Lehren, von denen die Bekannteste das sogenannte Höhlengleichnis ist. Platon verglich den Menschen, der keine Kenntnis von den wahren Ideen hatte, mit den Höhlenmenschen, die niemals die Sonne sahen und die Schatten in der Höhle nicht als solche sahen, sondern vielmehr glaubten, diese seien die echten und wahren Dinge.
Auch Platon hatte einen bekannten Schüler: Aristoteles. Dieser suchte jedoch nicht wie sein Mentor die Erkenntnis in der platonischen Ideenlehre. Er versuchte vielmehr, die Wirklichkeit der Natur in Verbindung mit der menschlichen Gesellschaft zu erforschen und die Ergebnisse in wissenschaftliche Kategorien einzuordnen.
Sokrates, Platon und Aristoteles sorgten mit ihren philosophischen Betrachtungen für die Gründung weiterer Denkschulen und gelten als die Klassiker der griechischen Philosophie.
Neben den großen Philosophen haben auch die Mathematiker im antiken Griechenland herausragende Leistungen erbracht, die heute sowohl in der Schule als auch im Alltag ihre Anwendung finden. Mit Thales von Milet und vor allem Pythagoras von Samos wurde die Mathematik als Wissenschaft institutionalisiert.
Vor allem auf dem Gebiet der Notation haben sie durch die Nutzung des Alphabets große Fortschritte erzielt, da somit nicht nur die Kennzeichnung erleichtert wurde, sondern der Einsatz von Buchstaben das Herleiten allgemeingültiger Grundsätze ermöglichte. Der bekannteste griechische Mathematiker war Archimedes, dessen Auseinandersetzung mit krummlinig begrenzten Körpern und Figuren bahnbrechend war. Da die meisten Mathematiker auch als Philosophen auftraten, gelang es ihnen, ihre Forschungen in geschickte Formulierungen zu kleiden und somit der Nachwelt zu erhalten.
Das Weltreich des alten Roms
In der Antike war das Römische Reich das größte Imperium der Welt. Es erstreckte sich von Schottland im Norden bis zur Sahara im Süden, von der Atlantikküste Spaniens im Westen bis nach Syrien im Osten. Dabei war zwar die Erschaffung eines Weltreiches niemals das erklärte Ziel, jedoch machten es die effizienten Strukturen, die militärische Stärke und die zivilisatorischen Neuerungen möglich, von Sieg zu Sieg zu eilen.
Der Sage nach entstand Rom durch die Brüder Romulus und Remus. Beide waren Söhne des Mars und wurden von einer Wölfin großgezogen. Nach einem Streit tötete Romulus seinen Bruder und wurde somit zum Begründer der Stadt am Fluss Tiber, die eigentlich durch den Volksstamm der Etrusker aus mehreren Dörfern zu einer Siedlung zusammengefasst wurde.
Die römische Gesellschaft bestand im Wesentlichen aus zwei großen gesellschaftlichen Gruppierungen. Die adligen Patrizier übernahmen nach der Abschaffung der Königsherrschaft zusammen mit den zunächst noch reichen Plebejern die Macht. Nach etlichen Kriegen verschuldeten sich die Plebejer jedoch zusehend und verloren ihre Stellung. Daher kam es zu Spannungen zwischen den beiden Gruppierungen, die schließlich 494 v. Chr. durch Reformen und Zugeständnisse an die Plebejer beendet werden konnten.
Zwar existierte im alten Rom keine schriftlich festgehaltene Verfassung, jedoch gab es klare Hierarchien und Ämter. Bis zur Einführung der Monarchie unter Cäsar und Augustus waren die Konsuln die höchsten und wichtigsten Männer im Reich, die für jeweils ein Jahr gewählt wurden und ihr Amt stets zu zweit ausübten. Sie wurden von Beamten, die über die Steueraufkommen (Zensoren), die Rechtsprechung (Prätoren) und andere öffentliche Angelegenheiten wachten, unterstützt.
Das römische Regierungssystem erwies sich als äußerst effizient und half nicht zuletzt, das Reich durch Feldzüge bis 272 v. Chr. auf ganz Italien auszudehnen. In den drei Punischen Kriegen gegen Karthago, die sich über 100 Jahre hinzogen, konnte Rom schließlich auch eine Vormachtstellung im Mittelmeerraum erringen. In der folgenden Zeit gelang es den Römern, zunächst die großen Mittelmeerinseln, dann auch Nordafrika sowie Spanien und Griechenland zu erobern. Als Organisationsform für die eroberten Provinzen bedienten sich die Römer verschiedener Möglichkeiten. Die Gebiete wurden entweder der Stadt Rom direkt unterstellt oder blieben autonome Provinzen.
Nach dem Übergang von der Republik zur Monarchie im ersten vorchristlichen Jahrhundert nahm der römische Expansionsdrang weiter zu. Zunächst wurden Gallien und Ägypten von Cäsar unterworfen und Augustus versuchte sich an der Eroberung der rechtsrheinischen Gebiete. Diese wurden zunächst erkundet und sollten später zu Provinzen gemacht werden. Allerdings mussten sich die Römer nach der Niederlage gegen Arminius zurückziehen. Nachdem die Feldzüge nicht den gewünschten Erfolg brachten, musste Rom das Land östlich des Rheins komplett aufgeben. In der Folge konzentrierten sich die Römer auf die Eroberung anderer Gebiete. Dazu zählten das heutige Großbritannien sowie das Partherreiches im Osten. Unter Kaiser Trajan erreichte das römische Weltreich 117 n. Chr. seine größte Ausdehnung. Nachfolgende Herrscher versuchten, das Riesenreich aufrechtzuerhalten. Diese Aufgabe erwies sich nicht zuletzt durch innenpolitische Probleme als zunehmend schwierig. Letztlich trat das Reich, aufgrund Angriffe verschiedener Volksstämme in eine kontinuierliche Schrumpfungsphase.
Christentum und Islam
Unter Christentum versteht man im Allgemeinen die Religion jener, die an Jesus Christus als Sohn Gottes glauben und nach dessen Lehren leben. Heute besitzt die Religion über zwei Milliarden Anhänger, die sich im Wesentlichen auf drei Hauptgruppen verteilen. Die katholische, protestantische und orthodoxe Kirche.
Die Wurzeln des Christentums liegen bei einer Gruppe von palästinensischen Juden, die Jesus als den Messias verehrten. Der Überlieferung nach sollte Jesus die römische Herrschaft in Palästina beenden. Die Lehren Christus wurden nach dessen Kreuzigung durch seine Jünger weiterverbreitet, insbesondere durch Paulus, der in Griechenland, Rom und Kleinasien wirkte. Paulus konnte viele für die neue Religion begeistern, da sie im Gegensatz zum Judentum weit weniger auf die Einhaltung von rituellen Verpflichtungen bestand und sie damit als monotheistische Religion für viele attraktiver als das Judentum erschien. Nach anfänglichen Verfolgungen und Bedrohungen der Christen im Römischen Reich breitete sich die Religion immer weiter aus und wurde schließlich unter Kaiser Konstantin im Jahr 313 zur Staatsreligion erhoben. Bereits hundert Jahre früher begannen die Führer der neuen Kirche die wichtigsten Schriften im sogenannten Neuen Testament, der Bibel, zu sammeln, wobei erst im Jahr 382 die Auswahl beendet wurde.
Mit der zunehmenden Ausbreitung des Christentums nahmen auch Kontroversen bezüglich der Organisationsformen sowie der Lehre zu und es bildeten sich zwei Kirchenzentren heraus. Im Osten Konstantinopel und im Westen Rom.
Das politisch sehr einflussreiche Papsttum im Westen konnte nach dem Zerfall des Römischen Reiches schließlich sukzessive an Macht gewinnen und war bis ins Mittelalter auch politisch sehr einflussreich. Eindrucksvoll lässt sich das durch die Aufrufe zu den Kreuzzügen belegen. Im Verlauf der Zeit schmälerte sich jedoch der Einfluss des Papsttums. Schließlich führte die einsetzende Reformation im 16. Jahrhundert zur Spaltung der Kirche.
Etwa 570 n. Chr. wurde der Araber Mohammed in Mekka geboren. Ihm erschien der Überlieferung nach im Jahr 610 der Erzengel Gabriel und übermittelte ihm die Botschaften Allahs sowie die ersten Verse des Korans. Mohammed wurde damit beauftragt, diese zu predigen und neue Anhänger zu gewinnen. Nachdem er 622 zusammen mit einigen Anhängern Medina verlassen musste – dieses Jahr markiert zugleich den Beginn der islamischen Zeitrechnung –, besiegte er seine Feinde und verbreitete als Herrscher und Prophet die Verse des Korans, Suren genannt, in der arabischen Welt. Die Nachfolger Mohammeds wurden Kalifen genannt und sorgten für die Weiterverbreitung der Lehren Allahs. So dehnte sich der Islam sehr schnell aus und es gelang ihm, durch die Eroberungszüge der Araber sich im Nahen Osten und in Nordafrika bis 700 n. Chr. auszubreiten. Bemerkenswert ist dabei, dass es keine Zwangsbekehrungen gab, sondern Christen und Juden unter Abgabe von Sondersteuern ihre Religion weiter ausüben konnten. Innerhalb eines Jahrhunderts nach Mohammeds Tod drangen die Moslems sogar über Spanien nach Europa vor und konnten erst von Karl Martell 732 aufgehalten werden. Dadurch wurde eine weitere Ausbreitung des Islams in Europa verhindert.
Die Auseinandersetzungen zwischen Christentum und Islam bildeten im weiteren Verlauf eines der Wesensmerkmale des Mittelalters. Vor allem die Kreuzzüge der Christen, die unternommen wurden, um das Heilige Land und Jerusalem von den Moslems zu befreien, arteten in großer Gewalt aus. Nachdem Jerusalem zunächst im Ersten Kreuzzug 1099 von den Kreuzrittern erobert werden konnte, gelang es den Arabern schließlich unter Saladin, die Gebiete Palästinas wieder zurückzuerobern. Das führte zum Aufruf weiterer Kreuzzüge, die für das Christentum stets in einer Niederlage endeten. Teilweise scheiterten sie schon lange vor der Ankunft im Heiligen Land, so wie 1204, als die Kreuzfahrer nur bis Konstantinopel kamen und die Stadt plünderten.
Mittelalter
Ein neues Zeitalter: Renaissance und Humanismus
Bereits im 13. Jahrhundert, also noch während der Zeit des Spätmittelalters, entwickelte sich in Italien eine kulturelle und soziale Strömung, die sich mit den Künsten und dem Geist der Antike beschäftigte. Vor allem in den reichen Stadtstaaten machten es sich Gelehrte und Künstler zu Aufgabe, die noch lesbaren Überreste der Antike zu erforschen. Obwohl durch die Zeit der Völkerwanderung in Europa sehr viele Überlieferungen aus der Antike verloren gingen, waren es vor allem die Araber, die viele Werke und Texte antiker Autoren erhalten haben. Gleiches gilt für die nach wie vor von Christen bewohnte Metropole Konstantinopel. Auf den immer wichtiger werdenden Handelswegen kamen so Bücher und Gelehrte nach Italien. Dies führte dazu, dass sich die alten Ideen ausgehend von Italien in einer rasanten Geschwindigkeit europaweit verbreiteten.
Das Interesse an antiken Stoffen und neuen Erkenntnissen war nicht zuletzt durch die herrschenden Umstände des Alltags begründet. Die grassierende Pest führte dazu, dass intensive Studien über den menschlichen Körper betrieben wurden. Dies spiegelte sich auch in der Kunst wider. Hauptvertreter waren Leonardo da Vinci und Michelangelo. Die theozentrisch, also auf Gott bezogene Geisteshaltung wurde durch die einsetzende anthropozentrische Einstellung abgelöst. Der Mensch geriet in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Latein war nicht mehr die Universalsprache der Dichter und Autoren. Erstmals wurde auch eigenen Sprachen und Dialekten eine größere literarische Bedeutung beigemessen.
Mit der Renaissance entstand auch im Denken der Menschen die Idee eines neuen Zeitalters. Bedingt durch neuste Erkenntnisse in Forschung und Wissenschaft verlor die alte Idee der Vier Reiche an Bedeutung. Eine bis dahin unbekannte Aufbruchsstimmung wurde ausgelöst. Eines der Grundprinzipien bestand dabei in der Förderung des menschlichen Geistes. Die neue Geisteshaltung bestand darin, dass Bildung das Hauptziel menschlichen Strebens sein sollte. Ziel war es, den Menschen durch Bildung „menschlich“ werden zu lassen und ihn somit vom Tier zu unterscheiden. Abgeleitet vom lateinischen „humanus“ sollte der Mensch schließlich einen Idealtypus vertreten, den uomo universale. Ebenso wie die Renaissance hatte der Humanismus seine Wurzeln im spätmittelalterlichen Italien. Die Impulse kamen zu großen Teilen aus den Büchern, die während des Untergangs Konstantinopel im Jahr 1453 gerettet werden konnten. Inhaltlich setzten sich die Humanisten mit der wissenschaftlichen Betrachtung der Philosophie, Literatur und den Sprachen der Antike auseinander. Die antike Kultur wurde dabei als Vorbild angesehen und die überkommenen Ideen der christlichen Scholastik hinterfragt. Den christlichen Glauben stellten die Humanisten dabei jedoch nicht infrage, vielmehr rückte der Mensch als Ebenbild Gottes in den Fokus der Betrachtungen. Als berühmtester Humanist gilt Erasmus von Rotterdam, der mit satirischen Werken gegen weitverbreitete Irrtümer vorging. Die humanistische Bildungsbewegung hatte letztlich großen Einfluss auf die Reformatoren und deren Gegenbewegungen.
Amerika und die Entdeckung der neuen Welt
Begründet durch den Humanismus und das einsetzende Streben nach Bildung und Forschung bekam die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Form und Gestalt der Erde eine neue Bedeutung. Geografen begannen, alle bisher gesammelten Informationen zu nutzen und Weltkarten sowie Globen zu erstellen. Ihnen gemein war zumeist die Annahme, dass es eine Möglichkeit geben muss, Asien auch in westlicher Richtung über das Meer zu erreichen. Durch technische Verbesserungen gelang es, neue Schiffstypen wie die Karavelle zu entwickeln und die nautische Navigation erheblich zu verbessern. Lange Reisen auf den Ozeanen wurden dadurch möglich und der Wettlauf nach dem schnellsten Weg bis Asien begann.
Die Portugiesen versuchten auf ihrem Weg nach Asien, Afrika zu umsegeln, während Christoph Kolumbus die spanische Königin für den Westweg gewinnen konnte. Kolumbus brach 1492 mit drei Schiffen auf und entdeckte, nachdem seine Männer schon zweifelten, überhaupt wieder Land erreichen zu können, schließlich Amerika. Kolumbus landete zunächst auf einigen vorgelagerten Inseln der Karibik. 1498 gelang es ihm erstmals, den amerikanischen Kontinent zu betreten, von dem er annahm, dass es sich um Indien handeln müsse. Seinen Namen erhielt der neue Kontinent jedoch nicht von Kolumbus, sondern durch den Italiener Amerigo Vespucci, der als Erster begriff, dass es sich um einen neuen, unentdeckten Kontinent handeln müsse. Nachdem die Portugiesen durch Vasco da Gama den Seeweg um Afrika nach Indien bewältigten, übernahmen Spanien und Portugal die Vorherrschaft über den Welthandel. Gehandelt wurde hauptsächlich mit Gewürzen und Edelmetallen. Da ihnen andere Seefahrernationen in nichts nachstehen wollten, kam es sukzessive zur Aufteilung der neu entdeckten Gebiete. Die Europäer teilten sich die neue Welt untereinander auf.
Kolumbus war jedoch nicht der Erste, der Amerika „entdeckte“. Bereits zuvor hatten die Skandinavier auf dem Kontinent Fuß gefasst und errichteten erste Siedlungen auf Neufundland. Jedoch hatten ihre Entdeckungen keinen großen Einfluss auf das Weltgeschehen. Das Verhältnis zwischen Ureinwohnern und Europäern wurde erst durch Kolumbus nachhaltig beeinflusst.
Weit vor der Besiedlung durch die Europäer hatten sich auf dem amerikanischen Doppelkontinent Ackerbaugemeinschaften und sogar Hochkulturen entwickelt. Bereits im 4. Jahrhundert n. Chr. waren die Maya eine eigene Hochkultur, die allerdings 850 n. Chr. an Bedeutung verloren hatte und schließlich nur noch auf der Halbinsel Yucatán existierte.
Die Inkas hatten in Südamerika um 1200 n. Chr. ein Reich gegründet, das durch Eroberungen bis ins 15. Jahrhundert hinein zu einer Großmacht aufstieg. Sie entwickelten eine eigene Adelsschicht und begannen ihr bergiges Land durch Terrassenanbau zu kultivieren. Außerdem installierten sie ein komplexes Straßen- und Nachrichtenwesen, dass eine funktionierende Verwaltung auch in unwegsamen Gebieten ermöglichte.
Die dritte Hochkultur wurde von den Azteken begründet. Auf dem Gebiet des heutigen Mexiko-Stadt errichteten sie ab 1200 n. Chr. ein Reich, dessen Herrschaft sich bald auf ganz Mexiko ausdehnte. Ihre Hauptstadt Tenochtitlán war zum Zeitpunkt, als die Spanier in Amerika Fuß fassten, mit 200 000 Einwohnern die damals größte der Welt. Allerdings basierte die Herrschaft der Azteken auf grausamen Menschenopfern und der Sklaverei. Als es zu blutigen Konflikten mit den Spaniern kam, bei denen viele Azteken ihr Leben ließen, erfuhr die Hochkultur jedoch Unterstützung von den zuvor unterdrückten Völkern Mittelamerikas.
Reformation: Spaltung der christlichen Kirche
Die Geschichte des europäischen Abendlandes erlebte im 16. Jahrhundert eine entscheidende Wende. Angestoßen durch den Reformator Martin Luther spaltete sich die katholische Kirche in zwei Bewegungen auf, die noch heute das Glaubensbild der Christen in aller Welt prägen.
Der konkrete Anlass zur Reformation bestand in der Tradition der katholischen Kirche, dass sich Christen durch einen Ablassbrief von ihren Sünden freikaufen konnten. In der Region um Magdeburg fand dieser Ablasshandel einen besonders dreisten Nutznießer in dem Kardinal Albrecht, der nicht nur seine Ämter allesamt gekauft hatte, sondern sich diese zusätzlich beim Papst mit weiteren Zahlungen genehmigen ließ. Der Papst wiederum nutzte die Gelder des Ablasshandels nicht etwa zur Stärkung des Glaubens und der Kirchenarbeit, sondern investierte es lieber in eine ausufernde Hofhaltung und den Bau des neuen Petersdoms.
Dem Mönch und Theologen Martin Luther waren solche Praktiken zuwider. Er prangerte das Verfahren des Ablasshandels in 95 Thesen 1517 öffentlich an. Allerdings fanden sie weder beim Kardinal noch beim Papst Gehör, da sie um ihr einträgliches Geschäft fürchten mussten. In der weiteren Auseinandersetzung mit der Kirche radikalisierte sich Luther zusehends, bis er schließlich 1521 im Wormser Edikt mit der Reichsacht belegt wurde, die ihn zum vogelfreien Menschen machte. Dies bedeutete, dass er keinerlei Rechte mehr besaß und selbst seine Ermordung nicht sanktioniert worden wäre. Luther konnte jedoch mithilfe der Unterstützung seiner Landesherren fliehen und zog sich auf die Wartburg zurück, wo er unerkannt leben konnte und das Neue Testament erstmals vom Lateinischen ins Deutsche übersetzte.
Luthers Thesen und die Reformation fanden in der damaligen Zeit nicht zuletzt aufgrund ständiger Krisen im Reich besonderen Anklang beim Volk und sogar einigen Landesfürsten. Als Kaiser Karl V. versuchte, die politisch-religiöse Einheit des Reiches zu bewahren und die evangelische Reformation zu verbieten, regte sich unter den Ständen Widerstand. Durch den Protest erhielt die neue Strömung ihren Namen: Protestantismus. Die Spaltung in zwei unterschiedliche Konfessionen ließ sich nicht mehr aufhalten und die Reformation fasste in Mittel- und Nordeuropa Fuß. Mancherorts löste die neue Ordnung Ausschreitungen unter den Gläubigen aus. Kirchenaltäre wurden zerstört und zur Auflehnung gegen die Obrigkeit aufgerufen. Luther lehnte diese Strömungen ab, da er die christliche Freiheit stets im Glauben suchte und nicht durch die Umkehr sozialer Verhältnisse zum Ausdruck bringen wollte.
Neben den Thesen Luthers gab es auch noch andere Reformbestrebungen, wie die des Geistlichen Ulrich Zwingli, dessen Reformprogramm Zulauf in Straßburg und Konstanz auslöste. Zu nennen sind auch die Ideen von Johann Calvin. Calvin floh zunächst aufgrund seines evangelischen Glaubens aus Paris in die Schweiz und schuf dort die Prädestinationslehre, der zufolge jedes Ereignis von Gott vorherbestimmt und die Freiheit des menschlichen Willens als äußerst gering zu betrachten sei. Calvins Thesen fanden vor allem dort viele Anhänger, wo tyrannische Herrscher wüteten. Dies war beispielsweise in Frankreich der Fall. Auch wenn der Calvinismus zu sehr strengen Regeln bezüglich des menschlichen Miteinanders führte, waren einige Forderungen Calvins als durchaus demokratisch zu bewerten. So sollten etwa Gemeindemitglieder ihre Pastoren zukünftig selbst wählen und die Geschäfte der Kirche von einer autorisierten Kirchenbehörde geleitet werden.
Glaubenskriege in Europa
Die neuen Thesen und Ideen der Reformatoren breiteten sich in vielen Teilen Europas aus und fanden eine immer größer werdende Zahl von Anhängern. 1525 bildeten sich im Heiligen Römischen Reich mit dem Dessauer Bund als Gegner und dem Torgauer Bund als Befürworter der Reformation zwei gegensätzliche Gruppen von Reichsständen. Die Konfrontation spitzte sich zu und die Protestanten bildeten schließlich 1531 den Schmalkaldischen Bund. 1547 konnte Kaiser Karl V. zusammen mit anderen Fürsten die Protestanten im Schmalkaldischen Krieg besiegen, woraufhin er deren Rechte durch das Augsburger Interim beschränkte.
Das Reich kam jedoch nicht zur Ruhe, sodass König Ferdinand 1555 mit dem Augsburger Religionsfrieden sowohl die katholische als auch die lutherische Konfession als gleichberechtigt ansah. Von nun an war es an den Landesherren zu bestimmen, welche Konfession in ihrem Land gelten sollte.
In Frankreich kam es im 16. Jahrhundert ebenfalls zu Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken. Die französischen Protestanten, Hugenotten genannt, erwiesen sich als starke Minderheitsgruppe und beide Konfessionen konnten sich nicht auf ein friedliches Zusammenleben einigen. Verschiedene Bürgerkriege brachen aus, die über vierzig Jahre hinweg Frankreich erschütterten. Erst 1598 gelang es mit dem Edikt von Nantes, den Frieden wiederherzustellen und den Hugenotten Rechte zuzugestehen. Die Koexistenz beider Konfessionen bestand in Frankreich bis 1685, als Ludwig der XIV. die religiöse Toleranz mit dem Widerruf des Ediktes von Nantes beendete.
Im Reich hatte der Augsburger Religionsfrieden zwar zunächst die Streitereien unter den Konfessionen beendet, jedoch hielt dieser Frieden nicht sehr lange. Nachdem der böhmische Erzherzog Ferdinand ohne Zustimmung der Stände neuer böhmischer König wurde und sogleich die Religionsfreiheit aufhob, kam es 1618 zum Aufstand. Die kaiserlichen Regierungsräte wurden durch aufgebrachte Vertreter der protestantischen Stände aus den Fenstern der Prager Burg geworfen. Der sogenannte Prager Fenstersturz markierte den Beginn des Dreißigjährigen Krieges, dem blutigsten aller Religionskriege in Europa. Er setzte sich aus vier großen Konflikten zusammen. Nachdem die Böhmen einen neuen König wählten und sich gegen den katholischen Kaiser stellten, wurden sie 1620 in der Schlacht am Weißen Berg von einer Armee des Feldherren Tilly geschlagen und schließlich „rekatholisiert“. Daraufhin griff der dänische König Christian IV. aufseiten der Protestanten in den Konflikt ein, wurde jedoch von den kaiserlichen Truppen unter Tilly und dem Feldmarschall Wallenstein geschlagen. Durch das Restitutionsedikt wurden daraufhin alle nach 1552 reformierten Gebiete wieder den Katholiken zugesprochen. Der schwedische König Gustav II. Adolf übernahm daraufhin anstelle der Dänen die Führung der Protestanten und es gelang ihm, die kaiserliche Armee in der Schlacht bei Breitenfeld 1631 zu schlagen und in der Folge weit nach Süden vorzudringen. Ein Jahr später fiel Gustav II. Adolf in der Schlacht von Lützen und die Schweden wurden aus Süddeutschland zurückgedrängt. Durch den Frieden von Prag 1635 wurde zunächst ein Waffenstillstand zwischen dem Kaiser und den protestantischen Reichsständischen geschlossen. Nun sahen die Franzosen ihre Interessen gefährdet, da sie, obwohl katholisch, die Gegner des Kaisers unterstützt hatten, um diesen zu schwächen. Es kam zum letzten Krieg, dem Französisch-Schwedischen, der sich von 1635 bis 1648 erstreckte. Der Westfälische Frieden beendete schließlich auch diesen Konflikt und bestimmte Frankreich und Schweden als Schutzmächte der Konfessionen im Reich.
Japan
Als in Europa die Moderne anbrach, kamen auch nach Japan und China die ersten europäischen Seefahrer und mit ihnen Entdecker und Kaufleute. Infolgedessen fand in Japan das Christentum Anhänger, wurde aber von der Militärregierung Japans, dem Shogunat, abgelehnt. Um 1600 hatte eine neue Dynastie die Herrschaft in Japan übernommen. Die Tokugawa verlegten die Hauptstadt nach Edo, das der Zeit seinen Namen gab. Nachdem bis 1639 immer mehr Japaner zum Christentum übertraten, verbot die Regierung die neue Religion und begann alle Ausländer des Landes zu verweisen. Daraufhin schottete sich das Land nach außen hin streng ab; eine Außenpolitik, die erst im 19. Jahrhundert endete. Die Regierung konzentrierte sich fortan auf den Handel mit China und erlaubte lediglich den Niederländern eine Handelsstation zu betreiben. Dadurch hielt sich auch der Einfluss westlicher Konzepte und Ideen, die als Rangaku (Hollandstudien) verbreitet wurden. Außerdem unterhielten verschiedene japanische Fürstentümer Handelsbeziehungen mit Korea und Russland.
Die Gesellschaft und Kultur Japans war in der Edo-Zeit von einer zunehmenden Urbanisierung geprägt. Zusätzlich wurden viele Lebensbereiche von marktwirtschaftlichen Prinzipien durchdrungen. Händler und Kaufleute aus den Städten erschufen einen neuen bürgerlichen Lebensstil. Dieser war jedoch mit hohen Kosten verbunden, den sich die in den Städten wohnenden Samurai nicht mehr leisten konnten. Dadurch gerieten sie in die Abhängigkeit von Kaufleuten und verschuldeten sich zusehends.
Die Kultur und Ästhetik Japans wurde zu dieser Zeit durch den Kriegerstand geprägt und in der Literatur und der Architektur herrschten konservative Stile vor. Handlungen wurden ritualisiert, wie es sich am Beispiel der Teezeremonie zeigt. Der zunehmende bürgerliche Wohlstand in den Städten prägte eigene Moden. Diese hielten in der Malerei, in neuen Formen des Theaters und dem Entstehen von Vergnügungsvierteln in den großen Städten Einzug.
China
Auch in China begannen sich Europäer zu Beginn der Frühen Neuzeit niederzulassen. Als erster großer und wichtiger Handelsposten erwies sich während des Endes der Ming-Dynastie das von den Portugiesen genutzte Macao. Nach fast 300 Jahren Regierungszeit sorgten soziale Spannungen und Unruhen für einen Verfall der Macht der Ming und aufständische Bauern marschierten auf die Hauptstadt Peking. Daraufhin erhängte sich der letzte Ming-Kaiser. Aus Verzweiflung wurden die Mandschu aus dem Nordosten Chinas zu Hilfe gerufen, die nach dem Sieg über die aufständischen Bauern die letzte Dynastie in China begründete. Die Qing-Dynastie blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein an der Macht. Zunächst konsolidierten sie ihre Macht und erweiterten sie um Tibet Xinjiang und die Mongolei, wodurch auch die Große Mauer ihre Bedeutung verlor und somit dem Verfall preisgegeben wurde. Die Erfolge der Mandschu waren nicht nur durch ihre militärischen Fähigkeiten begründet, sondern auch durch die effiziente Verwaltung.
Die Qing-Zeit war geprägt durch bedeutende kulturelle Leistungen. Wörterbücher und Lexika wurden geschrieben und berühmte Bücher verfasst. Innovationen in der Landwirtschaft ermöglichten ein rasches Anwachsen der Bevölkerung, die sich zwischen 1700 und 1800 beinahe verdoppelte. Insgesamt erreichte China unter der Qing-Dynastie im 18. Jahrhundert seine größte Ausdehnung und erlebte seinen bis dato politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Höhepunkt.
20 „Der Staat bin ich“ – das Zeitalter des Absolutismus
Der Übergang von der Frühen Neuzeit zur Moderne war geprägt durch die „Befreiung des Menschen aus seiner geistigen Unmündigkeit“ in der Aufklärung und dem Übergang vom Feudalismus zum Absolutismus. Der Absolutismus zeichnete sich dabei durch den Aufbau einer zentralen Verwaltung und geordneten Wirtschaft aus und wird vor allem mit der Person Ludwigs XIV. verbunden.
Theoretisch begründet wurden die absolutistischen Vorstellungen durch die Werke Jean Bodins und Thomas Hobbes im 16. und 17. Jahrhundert. Nach ihrer Ansicht ist der Mensch in seinem Naturzustand egoistisch. Das Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft ist daher geprägt von einem „Krieg“ jeder gegen jeden. Dieser Zustand kann nur überwunden werden, falls die Menschen ihre Macht durch einen Vertrag an eine übergeordnete Macht, bei Hobbes als Leviathan bezeichnet, abgeben. Konkret war diese Macht der Staat, der durch den König vertreten wurde. Die philosophische Begründung des Absolutismus war etwas Neuartiges. Sie bot dem König die Möglichkeit, seine Macht auszubauen und den Hochadel zu schwächen. Gleichzeitig konnte er dadurch sein Land zentralisieren und modernisieren.
Als Zentrum der neuen Regierungsform erwies sich dabei Frankreich und dessen König Ludwig XIV., der mit dem Satz „l‘état c’est moi“ – „Der Staat bin ich“ das charakteristische Wesen des Absolutismus zusammenfasste. Ludwig konnte sich auf eine effektive Beamtenschaft und eine zentrale Verwaltungsstruktur stützen. Das Land wurde in Verwaltungsbezirke aufgeteilt, die von Intendanten geleitet wurden. Sie waren verantwortlich für Steuern, Gerichte, Polizei und Straßenbau. Besonders wichtig war auch das stehende Heer Frankreichs, das reorganisiert, besser ausgestattet und vergrößert wurde. Der König übernahm darüber hinaus die Kontrolle der katholischen Kirche. Indem er über Stellenbesetzungen und Zensur päpstlicher Beschlüsse wachte, machte er sie zur Nationalkirche. Schließlich stellte er auch die Einheit der Kirche wieder her, indem er die Hugenotten durch die Widerrufung des Ediktes von Nantes 1685 aus Frankreich vertreiben ließ. Das wirtschaftliche Modell des Absolutismus war ebenfalls zentral gelenkt und wurde als Nationalwirtschaft den Prinzipien des Merkantilismus unterworfen. Zölle sowie Import- und Exportbeschränkungen sollten die einheimische Wirtschaft schützen und stärken.
Die soziale Ordnung wurde aufgeweicht. Dem reichen Bürgertum war es nun möglich, durch den Kauf von Ämtern in den Adel aufzusteigen. Diese Praktik wurde als „Noblesse de robe“ bezeichnet. Der König übte die Regierung an der Spitze des Staates aus. Ihn berieten die Fachminister des Kabinetts. Als Kontrolle über die Bevölkerung nutzte er die Geheimpolizei zur Überwachung, deren Methoden oftmals von Willkür geprägt waren. Ludwig verlegte den Königshof nach Versailles, damit er den Hochadel des Landes überwachen und kontrollieren und ihn somit von der Politik des Landes weitestgehend ausgrenzen konnte.
Das Modell des französischen Absolutismus fand überall in Europa seine Anhänger und Nachahmer. Es wurde auch an den deutschen Fürstenhöfen immer wichtiger. Charakteristisch für den Absolutismus war es, die absolute Macht durch eine möglichst ausufernde Hofhaltung und großen Prunk zur Schau zu stellen. Im 18. Jahrhundert hatte sich der Absolutismus als Regierungsform institutionalisiert. Er wurde in Frankreich erst durch die Französische Revolution beendet, wobei er sich im übrigen Europa noch bis ins 19. Jahrhundert hielt und erst durch die Ideen des Liberalismus verdrängt wurde.
Peter der Große – der Aufstieg Russlands
Peter der Große gilt bis heute als einer der wichtigsten und herausragendsten Monarchen Russlands und Europas. 1672 geboren, wuchs der künftige Zar mit den Ideen des Absolutismus auf. Es war seine Herrschaftsweise verbunden mit den Reformen, die er anstieß, die ihn später den Beinamen „der Große“ eintrug. Sein größtes Vermächtnis stellt jedoch die Gründung der Stadt St. Petersburg dar.
Da Russland über keinen Zugang zur Ostsee verfügte und die kürzeste Verbindung über Archangelsk sehr umständlich war, erkannte Peter die Notwendigkeit für die einheimische Wirtschaft, an der Ostsee eine neue Stadt zu erbauen, um den Kontakt mit Europa zu ermöglichen. Als Platz für die neue Stadt wurde dabei ein sumpfiger Küstenstreifen an der Newa ausgewählt. Zunächst entstand 1703 eine Befestigungsanlage, die Peter-Paul-Festung. Im Verlauf der nächsten Jahre wurde die Stadt St. Petersburg errichtet. Für den Bau wurden Tausende von Arbeitern zwangsverpflichtet, wobei viele von ihnen während der Bauzeit durch Unterkühlung, Unterernährung oder Angriffe von wilden Tieren ums Leben kamen. Adlige Familien mussten auf eigene Kosten Häuser bauen. Es entwickelte sich bald eine neue Stadt, die von Peter zur Hauptstadt des Russischen Reiches erklärt wurde.
Neben der Errichtung von St. Petersburg erzielte Peter aber auch auf militärischem Gebiet große Erfolge. So baute er eine Flotte auf, die gegen die Türken zum Einsatz kam und sich bei der Belagerung von Azov 1698 erfolgreich bewährte. Obwohl er anfänglich Niederlagen gegen die Schweden hinnehmen musste, gelang ihm nach mehr als 20-jährigen Kampfhandlungen schließlich 1709 ein großer Sieg gegen das Heer Karl XII. Dabei war Peter nach Aufenthalten in West- und Mitteleuropa bewusst, dass es in Russland dringend Reformen bedurfte, um es als Großmacht in Europa etablieren zu können. Die Umwälzung der Verhältnisse und Anpassung an Westeuropa begann zunächst mit der Umgestaltung des Staatsapparats. 1699 wurde eine Städtereform durchgeführt, die 1709 um eine Gouvernementsordnung erweitert wurde. 1711 wurde der Senat reformiert, außerdem führte er ein geistliches Reglement ein, dass die Macht des Patriarchen als Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche beschnitt. Peter veranlasste Kalender-, Schrift- und Kirchenreformen, regelte die Thronfolge neu und führte einen speziellen Dienstadel sowie die Kopfsteuer ein.
Auf kultureller Ebene war er sehr umtriebig und gründete ein öffentliches Theater sowie die Akademie der Wissenschaften. Bei seinen Reformbemühungen nahm er keinerlei Rücksicht auf Traditionen. So verbot er das Tragen von Bärten, was zu Widerständen führte, da Jesus selbst Bartträger war. Auch drängte er junge russische Adlige zu Reisen und Berufsausbildungen, um deren Müßiggang ein Ende machen zu können.
Es gelang ihm unter hohem persönlichen Einsatz, Russland zu einer Großmacht zu formen, das die Geschicke Europas in Zukunft mitbestimmen sollte. Wie groß der persönliche Einsatz Peters war, zeigt sich auch an seinem Tod. Peter starb an den Folgen einer Rettungsaktion, als er im Februar 1625 Soldaten eines gekenterten Bootes helfen wollte und selbstlos bis zur Hüfte durch eiskaltes Wasser watete. Seine Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen zeigte er also auch konsequent gegenüber sich selbst.
Der deutsche Dualismus: Habsburger und Hohenzollern
Der Aufstieg Preußens zur europäischen Großmacht ging einher mit dem Konflikt zwischen den Herrscherhäusern Preußens und Österreichs, die spätestens im 18. Jahrhundert um die Vorherrschaft im Heiligen Römischen Reich kämpften. Ihr Konflikt sollte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts andauern und erst durch den Sieg der Preußen bei Königgrätz 1866 beendet werden.
Bedingt durch eine Erbschaft fiel Ostpreußen an die Markgrafen von Brandenburg. Ihre Herrscher stammten seit dem 15. Jahrhundert aus dem Hause der Hohenzollern. Unter dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. erlebte Brandenburg eine erste Blütephase. Er schuf die Grundlage für den modernen preußischen Staat, entmachtete die Stände und privilegierte den Adel. Nachdem er zunächst die Macht der ostpreußischen Stände brechen konnte, führte er eine Verwaltungsreform durch. Darüber hinaus gelang es ihm mit der Ansiedlung der französischen Hugenotten, die Wirtschaft und Kultur seines Landes zu stärken. Die Stärkung seiner Armee konnte er eindrucksvoll in der siegreichen Schlacht bei Fehrbellin 1675 gegen die Schweden unter Beweis stellen. Dadurch wurden Schwedens Machtansprüche auf deutschem Boden beendet und Brandenburg stieg zur zweitgrößten politischen und territorialen Macht im Deutschen Reich hinter Österreich auf. Unter Friedrich Wilhelms Sohn, Friedrich III., erlangten die Hohenzollern die Königswürde für Preußen. Dessen Sohn König Friedrich Wilhelm I. baute eine effiziente und sparsame Verwaltung auf, reformierte die Finanzaufsicht und vergrößerte die Armee, ohne jedoch einen einzigen Krieg geführt zu haben. In dieser Phase von 1713 bis 1740 entspannte sich auch das Verhältnis beider Mächte, da der preußische König ergeben hinter dem Kaiser stand.
Nach der Machtübernahme Friedrich II. änderte sich das Verhältnis zwischen Preußen und Österreich rapide. 1740 überfiel und annektierte er mit der brandenburgisch-preußischen Armee Schlesien, das zum Habsburger Reich gehörte. Maria Theresa war zu jener Zeit die Erzherzogin von Österreich und führte einen erbitterten Krieg gegen Friedrich II. Nachdem Schlesien 1745 an Preußen abgetreten wurde, mussten sich die Preußen im Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763 erneut gegen die Österreicher zur Wehr setzen. Unterstützt wurde Österreich durch die Franzosen, Russen und Schweden. Nur durch glückliche Umstände konnten die Preußen eine Niederlage abwenden.
Auch in den folgenden Jahren blieb das Verhältnis zwischen Preußen und Österreich angespannt. Zwar waren sich beide Regierungen bei der Aufteilung Polens in der 1780er Jahren einig, doch als Napoleon die deutschen Gebiete bedrohte, konnten sich die Habsburger und die Hohenzollern nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Dies wurde beiden Großmächten letztlich zum Verhängnis; Napoleon triumphierte. Auch nach der Revolution von 1848 waren beide Länder bemüht, die Vorherrschaft in Deutschland zu übernehmen. Österreich fürchtete dabei stets, am Südostrand der deutschen Gebiete ausgegrenzt zu werden und versuchte daher die Pläne Preußens zur Reichseinigung unter preußischer Hegemonie zu unterbinden. Nachdem beide Länder noch 1864 gemeinsam gegen Dänemark kämpften, kam es im Anschluss zu schweren Spannungen, die im Krieg von 1866 endeten. Preußen konnte sich dabei aufgrund technischer Neuerungen in der Militärtechnik sowie der besseren Heeresorganisation durchsetzen. Österreich war infolgedessen gezwungen, seine Ansprüche im Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland aufzugeben.
Schritt in die Moderne: Amerikanische Revolution
Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts hatten sich an der nordamerikanischen Ostküste mehrere Kolonien gebildet, die bereits demokratische Verfassungen besaßen. Die Kolonien waren im Norden von Fischfang und Überseehandel geprägt, die Mitte lebte vom Getreideanbau und im Süden wurden hauptsächlich Plantagen für Baumwolle und Tabak betrieben, auf denen Sklaven arbeiteten. Die Kolonien hatten für sich die gleichen Rechte und Grundlagen eingefordert, wie sie in England durch die Magna Charta und die Bill of Rights garantiert wurden. Da sich die Kolonien nicht bloß als Rohstofflieferanten für ihr Mutterland sahen, verschärfte sich d
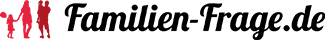
Add comment